Ganz ohne Gewalt geht es in der Psychiatrie nicht – aber der Umgang damit will gelernt sein. Dabei hilft das Verstehen der dahinter stehenden bewussten und unbewussten psychischen Prozesse und Dynamiken. Das war eine Quintessenz der Fachtagung über Gewalt und Zwang in der Psychiatrie aus psychoanalytischer Perspektive, die am 14. Juli in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Bethesda Krankenhaus Bergedorf stattfand. Veranstalter war der Arbeitskreis Psychoanalyse und Psychiatrie der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V.. Der EPPENDORFER sprach mit dem Bergedorfer Chefarzt Dr. Claas Happach über Gewalt – in und außerhalb der Psychiatrie.
EPPENDORFER: Warum gehört Gewalt dazu, wie Sie es mal an anderer Stelle gesagt haben?
DR. CLAAS HAPPACH: Ich halte Gewalt in der Beziehung in der Klinik für unausweichlich, weil die Situation, aus der die Patienten kommen, das oft mit sich bringt. Allein die Situation von Zwangsunterbringung in der Klinik ist schon Gewalt. Und Reden ist krankheitsbedingt nicht immer möglich, manches wird in solchen Situationen dann durch Handeln ausgedrückt, auch weil das Gegenüber für den Patienten zum Feind werden kann.
EPPENDORFER: Wie kann Psychoanalyse da helfen?
HAPPACH: Indem durch sie die Mechanismen klarer werden. Dadurch, dass deutlich wird, dass das Ganze im Unterbewussten angelegt ist, dass der Helfende durch Übertragungs- und Gegenübertragungsmechanismen auch zu Jemandem gemacht wird. Dies kann dann auch in das Gespräch mit dem Patienten nach einer Gewaltsituation erklärend einfließen. Die Fähigkeit, das Gegenüber als jemand anderen mit eigener Innenwelt zu sehen und sich über das, was der andere macht und auch sagt, Gedanken machen zu können, setzt Mentalisierungsfähigkeit voraus. Also eben die Fähigkeit, zu interpretieren, zu „lesen“, was in den Köpfen der anderen vorgeht und eigenes Handeln zu reflektieren. In welchem Ausmaß diese Fähigkeit zur Verfügung steht, ist von den frühen Bindungserfahrungen abhängig. Menschen, die in ihrer frühen Kindheit keine ausreichend gute Einfühlung erfahren haben, die früh traumatisiert oder misshandelt wurden, verlieren in Konflikten eher den kühlen Kopf, fühlen sich eher bedroht und kommen so eher ins Handeln – greifen an oder laufen weg.
EPPENDORFER: Gewalt wird verlernt und nicht erlernt, sagte der „Erfinder“ des Mentalisierungskonzepts, Peter Fonagy. Was meint das?
HAPPACH: Kinder erreichen mit ca. drei Jahren den „Gipfel der Gewalttätigkeit“. Sie haben dann von der Motorik her die Mittel zur Gewalt, aber noch nicht ausreichend Verstand im Sinne von Selbstkontrolle, um die Rechte der anderen im Sandkasten entsprechend zu akzeptieren. Die meisten Kinder werden später über Beziehungserfahrungen weniger gewalttätig. Aber es gibt eine kleine Gruppe, die bleibt auf einem hohen Gewaltniveau. Diese Kinder, meist Jungen, können sich nicht gut in das Gegenüber einfühlen.
EPPENDORFER: Kurz vor der Tagung in Ihrem Haus kam es im Zuge des G20-Gipfels in Hamburg zu heftigen Gewaltausschreitungen. Sie sprachen in dem Zusammenhang von einer neuen Dimension von Gewalt, was ist das Neue?
HAPPACH: Die Massivität, die Verführbarkeit zur Gewalt, das habe ich so noch nicht erlebt. Kollegen sehen das ähnlich.
EPPENDORFER: Hier wurden auch zuvor unauffällige bürgerliche Gymnasiasten plötzlich zu Plünderern. Die in großer Zahl über Film- und Handyaufnahmen verbreitete Dimension kollektiver Gewalt erschreckt besonders, was steckt da dahinter? Welche Bedeutung haben die Bilder der Gewalt?
HAPPACH: Das ist erst mal als Regression zu verstehen. Für solche Bewegungen sind Gruppen immer geeignet, das sieht man beim Fußball auch. Es zählt zu den grundsätzlichen Phänomenen der Gruppenpsychodynamik, dass dabei vorher besser kontrollierte Handlungsimpulse und Gefühle nicht mehr so gut kontrolliert werden und man sich mitreißen lässt. Ja, und vielleicht hatte es doch auch etwas mit der enormen Medienaufmerksamkeit zu tun, insofern, dass die Bilder etwas Verführerisches hatten und Größenphantasien ein Stück ins Handeln gebracht haben.
EPPENDORFER: Zurück zur Psychiatrie: Was passiert denn dort, wenn man auf Gewalt verzichtet?
HAPPACH: Prof. Joachim Küchenhoff aus Basel hat im Rahmen der Tagung Chancen und Risiken von Gewaltverzicht an Fallbeispielen deutlich gemacht. Ärzte geraten immer in ein ethisches Dilemma. So berichtete er von einer Frau, die Wahnvorstellungen hatte und an Krebs litt – sich aber nicht entsprechend behandeln lassen wollte. Aber das Behandlungsteam ließ sich umfangreich beraten, sprach sogar mit dem Mediziner und Bioethiker Prof. Giovanni Maio. Die Klinikmitarbeiter haben sich dann vor dem Hintergrund ihrer individuellen Geschichte dafür entschieden, die Entscheidung der Frau mitzutragen, keine Gewalt anzuwenden und sie nicht einer Zwangs-Krebsbehandlung zuzuführen. Sie haben stattdessen eine begleitende Haltung eingenommen.
EPPENDORFER: Thema geschlossene Türen: Die meisten Akutpsychiatrien halten geschlossene Stationen für Patienten in akuten Krisen vor, von denen Gewalt droht. Ein Konzept, das in jüngster Zeit durch neue Studien mehr und mehr ins Wanken gerät …
HAPPACH: Ja, Dr. Christopher Rommel, Chefarzt aus Brandenburg, hat von einer wachsenden Zahl an Studien berichtet, die besagen, dass offene Türen in der Psychiatrie nicht zu mehr Gefährdung führen, sondern eher ins Gegenteil. Er selbst leitet in Treuenbrietzen eine Psychiatrie, die ganz auf das Schließen von Türen verzichtet. Dort wurden am Stationsausgang „Runde Tische“ installiert. Dort sitzt jeweils ein Pflege-Mitarbeiter, der die Patienten, die raus wollen, aber nicht sollen, anspricht und mit ihnen redet. Das hilft oft, die Patienten auf Station zu halten.
EPPENDORFER: Aber in Bergedorf arbeiten sie zwar weiter ohne ganz geschlossene Stationen, aber mit fakultativ zu schließenden Bereichen. Warum verzichten sie nicht ganz auf das Einschließen? HAPPACH: In der Phase, als wir über Neuausrichtung sprachen und uns u.a. auch über das Weddinger Modell informierten, gab es bei uns eine Reihe von Patienten, die sehr gewalttätig waren, so dass wir uns das in der Phase nicht zugetraut haben. EPPENDORFER: Nimmt Gewalt in der Psychiatrie zu? HAPPACH: So ganz mit Zahlen belegen kann ich das nicht. Aber wir hatten hier eine Phase, in der wir mehr Gewalt gegen Sachen, aber auch gegen Mitarbeiter hatten als früher. Und ich habe das auch aus anderen Hamburger Psychiatrien gehört. Das stand einerseits im Zusammenhang mit jungen Geflüchteten in Krisensituationen, aber auch mit anderen jungen Leuten im Übergang zum Erwachsenenalter. EPPENDORFER Ihre Erklärung?
HAPPACH: Es gibt keine einfache Erklärung. Bei jungen Geflüchteten steht oft eine drohende Abschiebung oder mangelnde Perspektive im Hintergrund. Aber gleichzeitig geht eben auch viel mehr Gewalt von Menschen ohne Migrationshintergrund aus. Am gleichen Tag des Messerattentats in Hamburg-Barmbek, das wegen des vermuteten islamistischen Hintergrunds durch alle Medien ging, ist auch in Freiburg mit einem Messer auf einen Menschen eingestochen worden, der dann starb, darüber ist hier nicht berichtet worden.
EPPENDORFER: Was hilft gegen Gewalt in der Psychiatrie?
HAPPACH: Reden! Für eine UKE-Studie wurden Betroffene gefragt, was ihnen geholfen hat. Da wurden vor allem Gespräche mit Freunden, Angehörigen genannt. Wir in Bergedorf setzen zudem auf Beziehungskontinuität. Wir übernehmen aber auch einzelne Aspekte des so genannten Safewards-Konzepts – etwa Transparenz und Kommunikation. Und im Neubau, der vor einigen Wochen begonnen wurde, wird mehr Platz zur Verfügung stehen, auch das hilft. Zudem setzen wir darauf, die Patienten zu bemächtigen, etwa indem die Zimmertüren künftig von innen abschließbar sein werden.
EPPENDORFER: Ist die Psychiatrie in den letzten Jahren im Zuge von – durch Gerichtsurteile herbeigeführte – Gesetzesänderungen humaner geworden?
HAPPACH: Es ist wichtig und gut, dass die Diskussionen über Zwang und Gewalt öffentlich geworden sind und die Tätigen ihr Handeln mehr hinterfragen müssen. Das Dilemma ist, dass die gesellschaftliche Entwicklung eher rückläufig ist. Da sollen Menschen wie Herr Mollath richtigerweise nicht dauerhaft in der Forensik weggesperrt werden – aber in der Nachbarschaft sind sie auch nicht so gewünscht …
EPPENDORFER: Was ist die Aufgabe der Gesellschaft? HAPPACH: Abweichendes Verhalten zu akzeptieren. Wenn man nicht will, dass große Gruppen weggeschlossen werden wie in den USA, wo sich unter den Häftlingen auch viele psychisch kranke Menschen befinden, muss man vor allem für Toleranz sorgen. Wenn man eine Tür abschließt, wird sich auch jemand finden, der dagegen tritt.
Interview: Anke Hinrichs

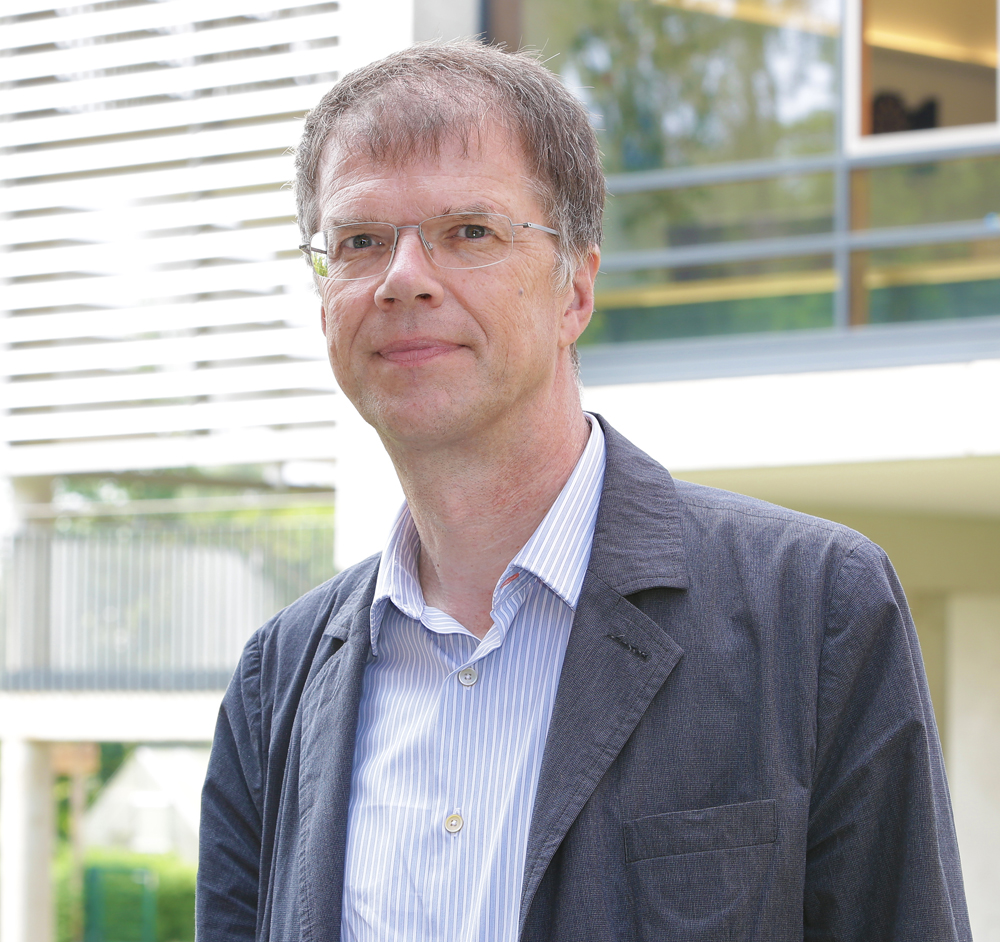 Dr. Claas Happach. Foto: Gabriele Heine.
Dr. Claas Happach. Foto: Gabriele Heine.